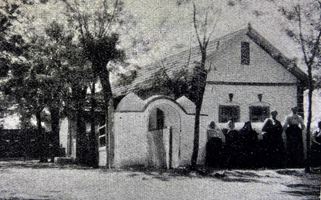Foto ©Angela Ilić
Den CfA als PDF-Datei finden Sie hier.
Das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa e.V. (IKKDOS), das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München e.V. (IKGS) und der Lehrstuhl für Kroatische und Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Split laden zu einer Sommerschule von 6. bis 8. Juli 2022 in München ein.
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende höherer Semester sowie DoktorandInnen aller Disziplinen, insbesondere aus den Bereichen Geschichtswissenschaft, Kulturwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kirchengeschichte und Theologie. Die Sommerschule findet in Präsenz – oder der aktuellen Pandemielage entsprechend in hybrider Form – statt, auch mit Teilnahme von Studierenden von der Universität Split.
Seminarinhalte:
Das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete neue Jugoslawien stellte die Beziehung zwischen Staat und Kirche auf eine völlig neue Grundlage. Ausgewählte Autoren sprechen gar von einem „Krieg gegen die organisierte Religion“ nach 1945. Dieses, anfänglich von Misstrauen, ideologisch basierten Entfremdung und Rachenwunsch belastete und sich mit dem Verlauf der Zeit wandelnde Verhältnis widerspiegelte zum einen Titos Machtkonsolidierungsmaßnahmen im Lande, zum anderen seine Versuche, Jugoslawiens Position auf der politischen Weltbühne zu sichern.
In der Sommerschule wird das komplexe Verhältnis von Religion und Gesellschaft durch die Analyse der Rolle der verschiedenen Religionsgemeinschaften und Kirchen am Beispiel der Entwicklungen auf dem Gebiet des sozialistischen Jugoslawiens unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erforscht. Die Beschäftigung mit dem Thema soll einen differenzierten und genauen Blick auf den Themenkomplex ermöglichen.
Die Erforschung des Lebens von Christen unter totalitären Herrschaften bedarf einer Vielzahl von Zugängen und methodologischen Ansätzen. Es wird daher in der Sommerschule bei der Behandlung des kirchlichen Lebens unter der kommunistischen Herrschaft eine Zusammenschau der religiösen Vorsätze und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen geben. Auch der komparative Blickwinkel und die Kontextualisierung spielen eine wichtige Rolle sowie die Einbeziehung von mikro- und makrohistorischen Ansätzen.
Inhaltliche Perspektiven und Fragen, die anhand ausgewählter Lektüre thematisiert werden:
- Die ideologischen/politischen Rahmenbedingungen („Eiserner Vorhang“, Kalter Krieg), die gesellschaftlichen Veränderungen (Technisierung, Urbanisierung, wie wir sie in den westlichen Gesellschaften in den 1950er-Jahren kennen) und ökonomische Umstrukturierungen sollen in ihren Folgen auf den Alltag, in dem religiöse Gemeinschaften lebten, befragt werden.
- Herrschaftsnähere und herrschaftsfernere Gruppen: Konfessionen im Vergleich. Welche Faktoren bestimmten die Gruppenidentität? Gab es formale, strukturelle, gar auch inhaltliche Parallelen zwischen der Herrschaftsideologie und religiöse Aussagen? Diente Ideologie als Ersatzreligion?
- Reaktion auf Repression im alltäglichen Leben, in der Theologie, „Widerstand“: Gab es in der Auseinandersetzung mit totalitären Systemen neben Konfrontation auch Phasen der Anpassung, vielleicht auch der Resignation? Oder gar der Kollaboration? Wer war aus welchen Gründen und mit welchen Intentionen dazu bereit?
- Welche Motive für Überlebensstrategien, für Anpassung, aber auch für Non-Konformität, für Widersetzen und Widerstand lassen sich jeweils feststellen? Welche Auffassung vom Menschen, von der Kirche, von den Aufgaben der Seelsorge, vom Staat verbirgt sich dahinter?
Teilnahme:
Die Veranstalter vergeben eine begrenzte Zahl an Stipendien für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Sommerschule. Diese Stipendien beinhalten zwei Übernachtungen, Verpflegung und die Übernahme von Reisekosten unter den vom Bundesreisekostengesetz vorgeschriebenen Bedingungen bis zu einer maximalen Höhe von 150 €. Bei der Veranstaltung wird ein der aktuellen Situation angemessenes Hygienekonzept verwendet.
Interessierte werden gebeten, sich bis zum 1. April 2022 um eine Teilnahme an der Sommerschule mit folgenden Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form zu bewerben:
- Motivationsschreiben (max. 2.500 Zeichen), in dem die Gründe für eine Teilnahme an der Sommerschule erläutert werden;
- tabellarischer Lebenslauf mit vollständiger Anschrift (Email- und Postadresse).
Die Bewerbung ist an Robert Pech, bertpech@yahoo.com, zu schicken. Die ausgewählten TeilnehmerInnen werden bis zum 30. April 2022 benachrichtigt und erhalten anschließend von den Veranstaltern weitere Informationen und Unterlagen (Lektüre) für die Vorbereitung.
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Aleksandar Jakir (Universität Split), Dr. Angela Ilić (IKGS München), Prof. Dr. Rainer Bendel (IKKDOS Tübingen)